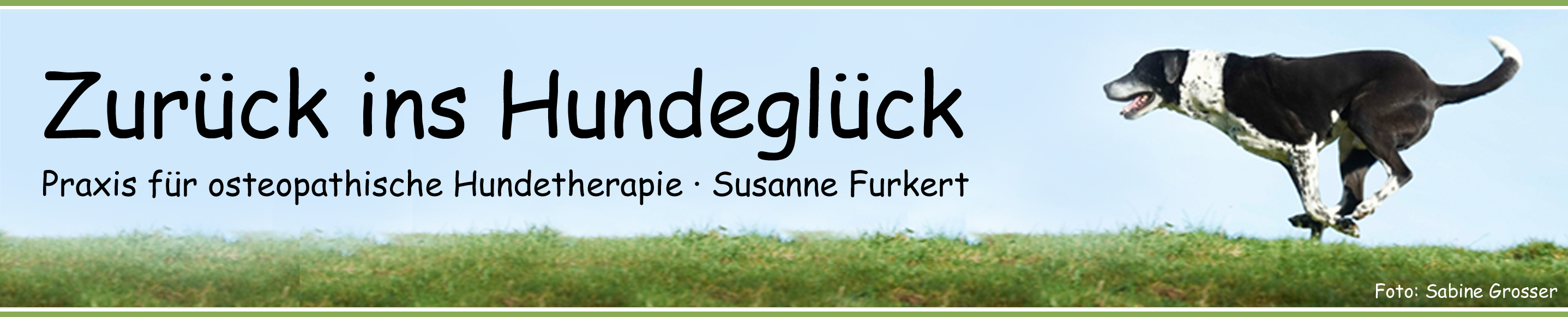Lieber Besucher meiner Internetseite,
vielleicht ist Ihnen schon aufgefallen, dass man mich nicht auf Facebook finden kann. Sicherlich hat Facebook enorme Vorteile. Man hat einen schnellen Zugriff auf benötigte Informationen, kann Facebook zu Werbezwecken nutzen, sich austauschen und Stellungnahmen abgeben. Darin liegt aber meines Erachtens auch eine große Gefahr, denn es kann wirklich jeder auch unqualifizierte und unwichtige Meinungen kund tun, und vor allem benötigt man Zeit, um seine Kontakte zu pflegen. Für mich persönlich habe ich fest gestellt, dass ich diese Zeit lieber anderweitig investiere.
Mein Beruf als Physiotherapeutin, Shiatsupraktikerin und Hundeosteotherapeutin schluckt in seiner praktischen Umsetzung enorm viel Zeit und ich möchte meine drei Standbeine seriös betreiben. Deshalb lese ich Fachliteratur, gehe auf Fortbildungen und Seminare oder behandle meine eigenen Hunde in der freien Zeit. Da uns Therapeuten wie vielen anderen auch eine hohe Konzentrationsfähigkeit und körperliche Fitness abverlangt wird, versuche ich zudem, meine Batterien aufzuladen, indem ich in die Natur gehe oder etwas Sport triebe. Das sind meine Kraftquellen. Würde ich ständig online auf Facebook chatten oder surfen, könnte ich mich nicht mehr entspannen und wäre nicht mehr fit für den Berufsalltag. Digitale Medien beschäftigen den Kopf, weniger das Herz. Dieses benötige ich aber für meine Arbeit. Achtsamer Umgang mit Facebook ist sicherlich möglich, erfordert aber selektives Verhalten und viel Disziplin. Ich möchte gar nicht erst in die Verlegenheit kommen, entscheiden zu müssen, wann und wieviel ich Facebook in mein Leben integriere.
Deshalb bitte ich um Verständnis. Ich möchte Ihnen aber ein anderes Angebot machen. Ich werde in Zukunft auf meiner Internetseite unter dem link: „Meine Meinung” Stellung beziehen zu aktuellen Themen rund um den Hund. Dies können beispielsweise kurze und verständlich formulierte Berichte zu Gelenkerkrankungen, Laufbandeinsatz, Training der Tiefenmuskulatur etc. sein.
Herzlichst, Ihre Susanne Furkert
Was Sie als Hundebesitzer von einer physiotherapeutischen/osteopathischen Behandlung erwarten dürfen:
Hinweis: Ich spreche hier aus Gründen der Vereinfachung immer von “ Der Behandler, der Hundebesitzer“. Natürlich ist damit immer auch die weibliche Form mit gemeint.


- Rahmenbedingungen:
Ihr Hund sollte den Raum, in dem er behandelt wird, als eine vertrauensvolle Umgebung wahrnehmen können. Hier spielen Lichtquellen, Helligkeit, eine Matte, auf der er sich gut ausbreiten kann, eine Rolle. Ich bevorzuge, Ihren Vierbeiner auf dem Boden auf einer Matte zu behandeln. Viele Hunde verbinden Bänke und Tische, die man hoch-, und runterfahren kann, mit einer Tierarztbehandlung. Ausserdem steht mir noch ein breiter niedriger Tisch zur Verfügung, aber auch eine Therapiebank. Diese kommt vor allem bei kleinen Hunden zum Einsatz, mit denen ich auf der Bank dann auch für meine Wirbelsäule schonend, Übungen durchführen kann. - Der Hund sollte sich zu Beginn im Raum frei bewegen können. Dies dient dazu, dass er über sein Sinnesorgan Nase alle wichtigen Gerüche aufnehmen-, und sich zu eigen machen kann. Dies stärkt das spätere Vertrauensverhältnis zwischen Hund und Therapeut. Diese wertvolle Zeit kann wunderbar dazu genutzt werden, mit dem Hundebesitzer die Erstanamnese zu beginnen.
- Mein Erstkontakt richtet sich nach dem Verhalten des Hundes. Natürlich bleibt er in der Zeit des Gesprächs mit dem Hundebesitzer von mir nicht unbeachtet. Bei ängstlichen Hunden vermeide ich Blickkontakt, nähere mich von der Seite, spreche mit ruhiger Stimme. Der Hundebesitzer spielt dabei eine wichtige Rolle. Ich bleibe mit ihm in Kontakt, denn er gibt mir vorab wichtige Informationen zum Wesen des Hundes. Er wird von mir mit in die Behandlung integriert und „darf“ auch mit mir und dem Hund gemeinsam runter auf die Matte. Meist ist es hilfreich, den Hund mit einem sanften Griff vorne um die Schulterpartie abzusichern, damit die Inspektion (Sichtbefund) und Palpation (Gelenk-,Muskelbefund) möglichst genau durchgeführt werden kann.
- Die Befundaufnahme besteht immer aus vorangegangenem Gespräch, in dem Fragen zu Zucht, Aufzucht, Haltung, Rasse, Alter, Auslastung, Ernährung, Unfälle, Krankheiten etc. beantwortet werden können. Diese Informationen sind ein wichtiger Bestandteil der späteren Behandlung und das Wissen darum fliesst später in die Auswahl der Behandlungstechniken mit ein. Anschliessende Ganganalyse sollte nicht fehlen, allerdings ist es hier tatsächlich hilfreich, wenn der Hundebesitzer ein Video erstellen kann zum Zeitpunkt der Lahmheit, denn nicht immer zeigen die Hunde Auffälligkeiten genau zum Zeitpunkt der Ganganalyse. Danach erfolgt eine ausführliche Untersuchung sämtlicher Wirbel-,und peripheren Gelenke, Muskelstatus, Faszienzustand, Sehnenansätze, Gewebszustände wie Schwellung und Erwärmung. Und genau an diesem Punkt ist zu vermerken, dass diese Herangehensweise nur dann funktioniert und auch wirklich nur in aller Ausführlichkeit so durchzuführen ist, wenn der Hund dafür die Ruhe und das Vertrauen zum Therapeuten mitbringt. Dies ist meistens in der ersten Therapiesitzung nicht zu erwarten. Deshalb schliesse ich meine Anamnese an dem Punkt vorerst ab, an dem ich merke, dass der Hund unruhig wird.Hier beginne ich mit der Behandlung, denn das, was ich bis jetzt über das Körpersystem des Tieres erfahren konnte, reicht aus, um eine Behandlung durchzuführen. Meistens erschließt sich auch noch während der Behandlung die ein- oder andere weitere Erkenntnis. Alle weiteren Informationen sammle ich in der nächsten Behandlungseinheit.
- Leitsatz: Der Hund führt durch die Behandlung! Als Mensch kann ich nicht wissen, wann das Energie- und Körpersystem des Hundes genug gefüllt ist mit heilenden Impulsen. Also achte ich auf feine oder auch deutlichere Zeichen des Hundes, die sich zeigt in Gähnen, unruhig werden, aufstehen wollen, zeigen. Damit weiss ich, dass nun erst einmal genügend Impulse gesetzt wurden. Und diese müssen nun weiterlaufend verarbeitet werden. Der Hund hat nicht wie wir Menschen den Verstand dazwischen geschaltet. Er wertet das Geschehen nicht. Die Therapie, das Arbeiten meiner Hände an seinem Körper-, und Energiesystem treffen ungefiltert aufeinander, so dass ich auch als Therapeut schneller als bei der Behandlung eines menschlichen Patienten die Rückmeldung bekomme, wann es genug ist an gesetzten Reizen. Wende ich manuelle Techniken an, gilt für mich das Credo der manuellen Therapie: Rhythmus, Routine, Rotation. Vor allem der Rhythmus spielt eine große Rolle: Je ruhiger und rhythmischer ich gewisse Gelenktechniken durchführe, desto mehr entspannt sich das System des Hundes.
- Und Damit wäre ich zum Schluss am wichtigsten Punkt angekommen: Dem Hund während einer Behandlung Schmerz zuzufügen, ist ein absolutes NOGO!!!! Aussagen wie: „ Das muss jetzt so sein, sonst hilft es nicht“, sind absoluter Quatsch und zerbrechen nur das Vertrauensverhältnis zwischen Hund und Therapeut. Ich arbeite sehr häufig und gerne myofaszial. Diese Art von Therapie ist sehr erfolgreich und wird meist mit damit verbundenem leichten oder stärkeren Schmerz in der Humanphysiotherapie angewendet. Auf den Hund übertragen, kann ich es mit genügend Feingespür definitiv so anpassen, dass es die gewünschte Reaktion erzielt und dem Hund trotzdem nicht weh tut. Es gilt weiter zu beachten, an welcher Körperregion ich gerade Reize setze bzw. arbeite. Der Bereich des Rückens (Yang Energie) ist deshalb sehr viel empfänglicher für sattere Reize als die gesamte sehr sensible Bauchregion (Yin Energie). Diese bedarf viel mehr Schutz als der Rücken. Darüber hinaus kann ich als Therapeut nur heilende Reize setzen, wenn ich im Vaguszustand therapiere. Der Vagusnerv ist der parasympathische Teil des autonomen Nervensystems, der das Körpersystem runterfährt. Er senkt Herzschlag, Atemrhythmus, Pulsschlag nach unten. Der Hund ist entspannt, seine Körperfaszien sind entspannt. Ist der Hund gestresst wegen Unwohlsein oder Angst vor Schmerz, dann befindet er sich im sympathikotonen Zustand: Alles ist hochgefahren und festgezogen. Der Hund hechelt, schmatzt, wehrt sich gegen die Therapie. In diesem Zustand ist es uns Therapeuten nicht möglich Heilungsimpulse zu setzen. Als Hundebesitzer erkennen Sie dies auch daran, wie gern der Hund zur Therapie kommt. Nach einer Anwendung sollte der Hund die Möglichkeit haben, für den Rest des Tages zu entspannen und viel zu schlafen. Trinken sollte ihm ausreichend zur Verfügung gestellt werden. Oft dient der Schluss einer Therapiestunde dazu, dem Hundebesitzer Fragen zu beantworten, die sich während der Anwendung ergeben haben oder die er mitbringt. Als Therapeut ist mir wichtig, dass die Art und Länge der Gassigänge besprochen werden, schädigende Einflüsse auf das Körpersystem zu minimieren oder die ein-, oder andere Übung oder Behandlungstechnik als Hausaufgabe mit auf den Weg zu geben. Dies dient dazu, das erreichte Behandlungsziel zu festigen.
- Zu allerletzt ist der Zyklus und die Anzahl der Therapie erwähnenswert: Um dem Heilungsprozess gerecht zu werden, ist es wichtig zu wissen, dass es nur Sinn macht, so viele Reize zu setzen wie nötig, so wenig wie möglich. Die beste Methode, dies herauszufinden, ist, mit dem Hundebesitzer drei bis vier Tage nach der ersten Behandlung zu telefonieren, um Infos darüber zu erhalten, wie der Hund auf die Behandlung reagiert hat. Daraus erschließt sich dann der Abstand zwischen den weiterlaufenden Therapieeinheiten. Und es macht einen Unterschied, ob es sich um ein chronisches Leiden handelt, das begleitend zur Zustandserhaltung regelmäßig behandelt werden muss oder ob es sich um ein postoperatives Geschehen handelt, oder eine akute Verletzung, die ausheilen wird.
- Und über allem sollte das Dach der Ruhe, Zeit, Geduld und des Einfühlungsvermögens gespannt werden!


Training der Tiefenmuskulatur beim Hund
Meine Meinung: Älter werdende Hunde leiden genauso wie wir Menschen an Gelenkverschleiß. Doch was bedeutet dieses Phänomen genau? Gelenkverschleiß stellt sich im Röntgenbild sicherlich immer mit Verkleinerung des Gelenkspalts, Aufrauungen des Gelenkknorpels, Veränderungen der Gelenkform und knöchernen Zu– und Anbauten dar. Doch was passiert mit Gelenkkapseln, Muskeln und Faszien? Auch sie reagieren auf krank machende Einflüsse! Beispielsweise können Gelenkkapseln schrumpfen, Faszien verkleben (Flüssigkeitsverlust), Muskeln verkümmern, sich Bänder oder Knochenhaut entzünden. Alles in allem ein schmerzhafter Prozess, der natürliche Bewegungs – und Verhaltensmuster verändert. Wir alle kennen das Phänomen von Steifigkeit auf der einen Seite und Kraft und Stabilitätsverlust auf der anderen Seite. Physiotherapie uns Osteopathie greifen hier ein und können den pathologischen Prozess je nach Grad des Stadiums abmildern, aufhalten oder eventuell sogar wieder rückgängig machen.
Ich werde oft gefragt, was man als Hundebesitzer bei sich abbauender Muskulatur tun kann, um Muskulatur wieder aufzubauen? Dazu muss gesagt werden, dass wir ab einem bestimmten Stadium des Krankheitsgrads und Alter des Hundes nur bedingt etwas gegen Muskelabbau tun können. Denn eigentlich möchte der Körper ein arthrotisches Gelenk versteifen und so arbeiten wir gegen das Programm des Körpers. Meine langjährige Tätigkeit in der Humanphysiotherapie und vor allem meine Arbeit mit Patienten, die an neurologischen Erkrankungen leiden, hat mir jedoch eines ganz besonders gezeigt: Es ist wichtig, dass der Hund seine Gelenke im Lauf auf unterschiedlichen Bodenqualitäten stabilisieren kann und dies erreiche ich nicht, wenn ich selektiv und einachsig bestimmte Muskelgruppen anspreche und trainiere. Das Trainingsprogramm muss funktionell sein, damit alle Muskelgruppen angesprochen werden, die ein Gelenk stabilisieren und sofort anspannen, wenn der Hund aus dem Gleichgewicht gerät oder sich die Bodenbeschaffenheit ändert.
Meine Meinung: Ein aktives Übungsprogramm sollte immer Trainingsreize zur Gleichgewichtsschulung, Abrufung von Haltungskontrolle und Stellreflexen beinhalten.
Klein, aber fein!
Am Samstag, den 22. September fand in Ulm/ Ziegelweiler das erste Süddeutsche Rollihundetreffen statt. Ich war dort und war begeistert! Auf einer kleinen Wiese waren circa sechs Stände aufgebaut, so dass es der Überschaubarkeit diente. Ich hatte genaue Vorstellungen über die Informationen, die ich mir einholen wollte. Tatsächlich betrifft es meine Hundepatienten, die entweder bereits mit einem Rollstuhl versorgt sind oder mit einem solchen Gefährt bestmöglich ausgestattet werden müssen. Darüber hinaus gibt es auch immer wieder Vierbeiner, bei denen man über eine Schienen oder Orthesenversorgung nachdenken muss. In diesen Bereichen hatte ich noch keine „Kollegen“ an der Hand, an die ich meine Hundepatienten mit gutem Gewissen weiter verweisen konnte. Diese Lücke hat sich seit dieser Veranstaltung zu meiner vollsten Zufriedenheit geschlossen.
Ich erhielt ausführliche Informationen über eine ordentliche Rollstuhlanpassung. Ein Hunderollstuhl muss einem Hund das gesamte restliche Leben zu seiner Fortbewegung dienen. Dass dieser nirgendwo drücken darf, stabil und gleichzeitig leicht sein muss, nicht kippen sollte im Gelände und darüber hinaus auch noch dazu geeignet ist, dass man ihn unkompliziert an- und ablegen kann, versteht sich eigentlich von selbst. Trotzdem ist dies keine Selbstverständlichkeit. Allzu oft sieht man Hunde mit bemühten Zwischenlösungen herumlaufen. Erstaunt stellte ich nebenbei fest, dass man als Rollstuhlanpasserin selbst sehr viele praktische Erfahrungen sammeln muss, bis man sich so gut auskennt, dass man wirklich für jeden gehandicapten Hund eine Lösung findet. Ich kann als Physiotherapeutin auch nur den Rat geben, dass man über eine Rollstuhlversorgung zu gegebenen Anlass nachdenken darf: Zum einen ist es eine Freude zu sehen, wie schnell Hunde den Rolli in ihr Leben integrieren und einfach nur glücklich sind, dass sie wieder an einem Leben im Freien teilnehmen können. Zum anderen kann ein Rolli durchaus als Therapiegerät gesehen werden. Denn es ist zu beobachten, dass einige Hunde wieder anfangen, die Laufbewegung der Hinterbeine mitzumachen, wenn sie nicht auch noch ihr Becken stabilisieren müssen. Hubfreies Bewegen führt also manchmal zu einer Reinnervation!
Passend zu einem individuell angepassten Rolli benötigt der Hund auch ein Geschirr, mit dem er seinen Rolli ordentlich ziehen kann, ohne in seinen natürlichen Gelenkfunktionen und Abläufen gestört zu werden. Eine Schneiderin aus Dachau, die bereits individuell angepasste Geschirre aus weichem und äußerst strapazierfähigem Material für gesunde Hunde herstellt, hat sich dazu Gedanken gemacht. Herausgekommen ist ein Geschirr, an dem die Verschnallungen eingenäht worden sind, an dem sie dem Körper und dem Fell des Hundes nicht schaden können oder Reibungen hervorrufen. Der Verlauf der Riemen ist so gestaltet, dass weder Gefäße oder Lymphbahnen eingeengt werden und das Schultergelenk in seiner Bewegungsfreiheit volle Kraft entwickeln kann. Auf keinen Fall darf ein Geschirr so gearbeitet sein, dass es quer verlaufend über das Schultergelenk zieht.
Ein Orthopädiemechaniker, der seit 25 Jahren Menschen mit Hilfsmitteln versorgt und seit zehn Jahren seine Tätigkeit auf Hunde und Katzen erweitert hat, lieferte mir schlüssige Beweise dafür, dass die Versorgung eines Haustieres mit einem Hilfsmittel durchaus Sinn macht und an erkrankten oder überlasteten Körperregionen zu nützlichen Entlastungen verhelfen kann. Gerade, wenn das Tier bereits ein gewisses Alter hat und eine Operation auszuschließen ist. Auch hier ist es unerlässlich, über ein tiefes und komplexes Wissen zu verfügen und auch mal an einer Schiene so lange zu tüfteln, bis sie wirklich passt und stabil sitzt.
Ergänzt wurde das Angebot an Informationen rund um die Rolliversorgung mit Fachvorträgen, und einer DOG DANCE Showeinlage. Alles in allem ein wunderbar gelungenes kleines „Event“, von dem ich mir mehr wünsche. Nichts ist meiner Meinung nach schöner, als mit engagierten Hundemenschen, die dem Hund ein würdiges Leben ermöglichen wollen, ins Gespräch zu kommen. Ein großes Dankeschön an die Veranstalter!
Die Kontakte zu oben genannten Fachleuten können bei mir erfragt werden.
Warum die Behandlung von orthopädischen Erkrankungen der Wirbelsäule auch immer eine neurologische Behandlung mit einschließt:
Degenerative Veränderungen an den Wirbeln ziehen meistens auch demenstsprechende Verletzungen der Nervenbahnen mit sich. Das liegt daran, dass zwischen zwei Wirbeln Nervenbahnen den Wirbelkanal verlassen. Sie entstammen dem Rückenmark, das den einzelnen Wirbeln dicht anliegt. Ihre Aufgabe liegt darin, entsprechende Muskelgruppen zu aktivieren, um eine Bewegung beispielsweise des Hinterbeines zu ermöglichen. Zu diesem Zweck haben ihre Endigungen Kontakt zu den Muskeln. Gleichzeitig vermitteln sie aber auch über ihre aufsteigenden Bahnen sensible Reize zum Rückenmark, die von dort weiter zum Gehirn geleitet werden.
Nun können sich aber die Nervenaustrittstore verengen, so dass die Nerven nicht mehr frei gleiten und gereizt werden. Dies passiert zum Beispiel durch Arthrose an den Wirbelgelenken. Hierbei bildet sich zusätzlicher Kalk , der den Raum dieser Austritte verkleinert. Knöcherne Nasen können entstehen und erschweren das freie Gleiten der Nervenbahnen. Dabei kommt der Impuls vom Nerven zum Muskel hin nur noch verzögert an und unsere Hunden zeigen uns die Auswirkung, indem sie plötzlich mit dem Becken zu einer Seite wegkippen, die Hinterbeine nicht mehr in der Streckung halten können oder anfangen, die Zehen schleifen zu lassen. Ihnen fehlt nun die sofortige Anpassung von Muskeln und Gelenken an Umweltreize. Der Muskel wird einfach zu langsam oder verzögert über nötige Anspannung informiert! Und um überhaupt eine gute Anpassung zu ermöglichen, braucht es immer die Feineinstellung mehrerer Muskelgruppen.
Macht es nun Sinn, primär als Ziel der Behandlung eine schwach gewordene Hinterbeinmuskulatur „aufzutrainieren“? In meinen Augen nicht, denn ich kann nichts gegen den Abbau von Muskelmasse tun, wenn ich den Nerven nicht dazu kriege, wieder freier zu gleiten und damit den Mukel besser zu aktivieren. Also benötige ich als Therapeut die dementsprechende Technik, den Nerven zu mobilisieren, um dann ein zielgerichtetes sensomotorisches Training , z.B. über Gleichgewichtsschulung , darauf aufbauen zu können. Sicherlich ist es nur bis zu einer bestimmten Grenze möglich, den Nerven bei verengtem Austrittstor zu mobilisieren, doch wenn man berücksichtigt, dass dabei bewegungshemmende Verklebungen gelöst werden können, ist es definitiv eine Möglichkeit, die Bedingungen für ein freies Gleiten des Nerven zu verbessern.
Entsprechend ihres Gebäudes sollten Hunde unterschiedlich ausgelastet werden
Die Vielfalt an unterschiedlichen Hunderassen und deren körperliche Ausprägung erfordert bei jedem Hundebesitzer die Überlegung, wie er seinem Hund an körperlicher Auslastung gerecht werden kann. Ich beziehe mich schwerpunktmäßig auf die anatomische Prägung, da dies mein Fachgebiet ist. Darüber hinaus spielen sicher auch charakterliche Unterschiede eine große Rolle. Diese werden am Rande gestreift.
Anhand einiger Beispiele möchte ich veranschaulichen, um was es mir geht. Die meisten von Ihnen werden es bereits wissen, doch es lohnt sich, den Blick für jeden einzelnen Hundekörper zu schärfen.
Es ist schon eine Weile her, da sah ich in einem Werbespot im Fernsehen folgendes:
Eine Bikinischönheit joggt im Hochsommer bei strahlendem Sonnenschein durch tiefen Sand eines Meeresstrandes. In Begleitung einer englischen Bulldogge, die ihr Gewicht ruckartig von der hinteren Extremität auf die vordere wuchtet, dabei mit den Vorderbeinen plump in den Boden einstauchend .
Ich lese in der Augsburger Allgemeinen einen Artikel über ein durchgeführtes Mopsrennen. Der Verfasser des Berichts amüsiert sich augenscheinlich über die „lustigen“ Atemgeräusche, die die Hunde dabei machen.
Ich sehe eine französische Bulldogge neben seiner Besitzerin im Sommer auf der Weldenbahn galoppieren. In ihrer Not scheinen sich ihre Augen noch stärker nach vorne in die Augenhöhle vorzuwölben. Die Besitzerin ist mit Inlineskates unterwegs.
Alle drei Hunderassen haben einen ähnlichen Körperbau und dieselben zuchtbedingten Probleme. Die englische Bulldogge ist zudem auch noch sehr massiv und schwer gezüchtet. Alle drei Rassen verfügen über einen sehr kurzen Hals und einen quadratisch geformten Schädel. Das bedeutet, dass diese Rassen nicht über die Streckung und damit die Verlängerung des Halses ihr Körpergewicht im Galopp von hinten über die Wirbelsäule nach vorne verlagern können. Sie laufen stumpf in den Boden hinein und verbrauchen dabei viel mehr Energie, sich vorwärts zu bewegen als ein anderer Hund mit normal langem Hals, schmaler Kopfform und langer Schnauze. Nun kommt auch noch erschwerend hinzu, dass diese Hunde durch die weggezüchtete Nase extrem verkürzte Atemwege haben und bereits in Ruhe häufig schon schlecht Luft bekommen. Sie einem Ausdauertraining zu unterziehen, ist deshalb auf mehreren Ebenen schwer gesundheitsschädigend.
Der Labrador ist schon seit vielen Jahren ein beliebter Familienhund. Zu recht! Meist verfügt er über einen harmonischen Körperbau, doch auch hier gibt es körperliche Auffälligkeiten zu beachten. Er kann entweder mit kurzem Rücken kompakt und runden Kopf gezüchtet sein oder auch,Typ 2, höher gestellt, mit schmalerem Kopf und längerer Schnauze. Bei Typ 1 fällt mir in dieser Verbindung leider häufig auf, dass der Labi zu Spreizfüßen neigt und seine Hinterbeine eher nach vorne führt, indem er einen Halbkreis beschreibt, anstatt die Beine in der Schwungbeinphase direkt unter den Bauch nach vorne zu setzen. Er neigt auch ab und zu zum Paßgang und zeigt in Kombination mit der kreisförmigen Bewegung seiner Hinterläufe eine vermehrte Seitneigung der Lendenwirbelsäule. Ab und zu schleift er mit den Krallen der Hinterpfoten, weil er die Beine nicht direkt mit ausreichender Hüftbeugung nach vorne unter den Bauch setzt.
In meinen Augen tut man den Labis mit oben genannten Körperbau keinen Gefallen, wenn man Agility betreibt. Oder sie zu Balljunkies erzieht, weil sie das Apportieren so sehr lieben. Ihre Gelenke werden einfach zu sehr belastet, wenn sie ständig Drehbewegungen abfangen müssen , beim Springen in die Luft danach in den Boden einstechen oder aus hoher Geschwindigkeit abrupt abbremsen müssen. Häufig sind sie dafür zu weich gefesselt bzw. besitzen ihre Faszien zu wenig Spannung bei gleichzeitig verhältnismäßig schwerem Körperbau. Auch tun sie sich schwer, sich im gestreckten Galopp von den Hinterläufen so abzustemmen, dass sie ihr Gewicht über die Wirbelsäule ohne Unterbrechung auf die Vorderläufe übertragen können. Häufig sieht es so aus, als würde die Bewegung in der Wirbelsäule stecken bleiben. Sieht man sich dazu im Vergleich einen Münsterländer oder beispielsweise einen Setter an, so erkennt man, was ich meine. Man hat das Gefühl, dieser Hund fliegt über den Rasen, denn die Schwingungsimpulse, die beim Abstemmen über die Hinterläufe auf die Wirbelsäule übertragen werden, setzen sich nahtlos in die vordere Extremität fort.
Ähnlich auch der Golden Retriever. Meist erscheint er in einem weichen faszialen Gewand, seine Gelenke sind eher überbeweglich. Er beeindruckt zumindest in jungen Jahren durch sein geschmeidiges Aussehen und Bewegungsverhalten. Dafür ist er ja auch gezüchtet: Ein Wasserapportierhund, der die geschossene Ente mit weichem Maul aus dem Teich holt. Seine Gelenke eignen sich nicht für permanentes Ball- oder Frisbeespiel.
Dann wiederum gibt es Hunderassen, die beinahe ein wenig „eingemauert“ in ihrem Körper wirken, weil sie ein sehr straffes Bindegewebe aufweisen. Das hat den Vorteil, dass ihre Knochen und Gelenke gut stabilisiert sind und sie über eine gute Sprung- und Federkraft verfügen. Ihr Nachteil besteht eher darin, dass sie sich weniger beweglich zeigen, vor allem was die Mobilität ihrer Wirbelsäule angeht. Hier hat wiederum der Goldie einen deutlichen Vorteil. Dobermänner oder Rhodesien Ridgebacks neigen dazu. Werden sie ein wenig älter, zeigen sie häufig Festigkeiten einzelner Wirbelsäulenabschnitte, bevorzugt Lendenwirbelsäule.
Ich möchte darauf hinweisen, dass die oben genannten Erwähnungen meiner Beobachtung aus der Praxis gepaart mit dem Wissen über Aufbau und Beschaffenheit von Knochen, Muskeln und Faszien entsprechen. Ich möchte nichts verallgemeinern, nur Tendenzen bzw. Neigungen heraus arbeiten.
Logischerweise stellt sich nun die Frage, wie man nun als Hundebesitzer seinen Hund körperschonend , doch unterstützend in seiner Entwicklung auslasten und fordern kann. Jeder Hund ist für sich einzigartig und liebenswert, doch manche brauchen etwas mehr Unterstützung, andere weniger, was ihren Auslauf angeht. Ich habe hier nur einige gängige Hunderassen genannt und viele Hundebesitzer haben wunderbare Mischlinge unter ihrer Obhut. Doch auch auf alle anderen Rassen und Mischlinge lassen sich meine Beobachtungen übertragen.
- Hat der Hund eine lange oder eher kurze Schnauze?
- Ist der Schädel eher quadratisch oder länglich geformt?
- Hat der Hund einen langen oder kurzen Rücken?
- Hals kurz oder lang?
- Neigt er zu Spreizfüßchen ?
- Wie groß, tief und massig ist sein Brustkorb?
- Und, Und ,Und…..
Unter Berücksichtigung der charakterlichen Ausrichtung habe ich mir für die körperliche Bewegung einzelner Hunderassen Gedanken gemacht:
Hunde mit kurzem und kompaktem Rücken, könnten z.B. mobilisiert werden, indem man Slalomlauf oder Laufen durch aufgestellte Pylonen macht. Ihnen tut Biegung der Wirbelsäule gut.
Hunde, die zu Überbeweglichkeit neigen und ein weiches fasziales Gewand tragen, könnten hinsichtlich Stabilität gefordert werden, indem man mit ihnen Gleichgewichtsschulungen durchführt. Beispielsweise auf unebenen Boden, Wackelbrett, Kreissl oder Laufen über Wurzelwerk.
Hunde, die die Hinterläufe halbkreisförmig nach vorne setzen, profitieren von Gangschulungen über Cavaletti. Vorzugsweise langsam und an der Leine. Sie dürfen lernen, ihre Hinterbeine abzuwinkeln und direkt unter den Bauch zu setzen.
Auch Hunden, die zu Passgang neigen, sollten einem Mobilitätstraining für den Rücken ausgesetzt werden. Trailing mit tiefer Nase oder Fährten eignet sich für Hunde mit kurzem, kompaktem Rücken: Hierbei erfährt die Rückenstreckmuskulatur Dehnung. Das betrifft auch die Hunde mit kurzen Nasen. Sie zeigen oft auch kurze und feste Rückenlinien, v.a. wenn auch noch- wie bei der englischen Bulldogge- ein schwerer Brustkorb dran hängt. Balanceübungen und Biegearbeit sind hierbei zudem sehr hilfreich!
Da alle Hunde über Spürnasen verfügen, finde ich das Trailing als weniger spezifische, aber dafür körpertrainierende Auslastung immer gut. Ich glaube, das können alle Hunde machen. Und hat man einen Hund mit starkem Jagdtrieb, lässt sich dieser ja wunderbar in alle genannten Übungsbereiche mit einbauen. Da ja vor allem viele Kleinhunderassen jagdlich gut aufgestellt sind, fände ich es toll, wenn auch sie von Geschicklichkeitsübungen oder Nasensucharbeit profitieren dürften. Klein und niedlich bedeutet ja nicht, dass man sie reduzieren muss auf Gassigänge an der Flexileine um den Häuserblock.
Meine Meinung!